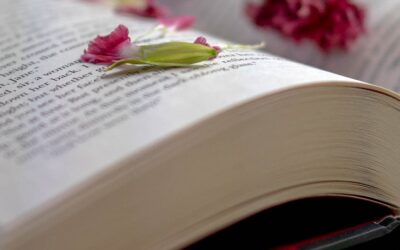Thema
Palliative Care und Spiritual CareSeit mehr als fünfzig Jahren hat sich Palliative Care als Bezeichnung für eine ganzheitliche Betreuung von Menschen am Lebensende etabliert. Spiritual Care, eine jüngere Teildisziplin, bemüht sich um den Einbezug von Religiosität und Spiritualität, denn beide beeinflussen die Lebensqualität massgeblich. Aktuelle Leitlinien informieren über das komplexe Thema.
Palliative Care
Palliative Care ist ein Schlagwort für die Betreuung von Menschen am Lebensende. Sie umfasst die Betreuung und Behandlung von Menschen mit unheilbaren, lebensbedrohlichen oder chronisch fortschreitenden Krankheiten, so die Nationalen Leitlinien Palliative Care aus dem Jahr 2010. Patientinnen und Patienten solle eine ihrer Situation angepasste «optimale Lebensqualität bis zum Tode» gewährleistet werden.
Für die Weltgesundheitsorganisation WHO entspricht Palliative Care einer Haltung und Behandlung, welche Schmerzen und andere physische, psychosoziale und spirituelle Probleme frühzeitig und aktiv sucht, immer wieder erfasst und angemessen behandelt.
Sterben in Würde bedeutet nicht nur, selber entscheiden zu können, so das Netzwerk palliative.ch. Es heisst auch, Zuwendung und Anteilnahme zu erfahren und von den Mitmenschen gestützt und begleitet zu werden.
Seinen Ursprung hat der Begriff in der Hospizbewegung, die in den 1960er Jahren unter anderem von Cicely Saunders begründet wurde. Sie sprach zunächst von Care of the Dying, später von Hospice Care. Von ihr inspiriert, eröffnete der kanadische Arzt Balfour Mount in Québec eine hospizähnliche Abteilung der soins palliatifs auf: der Begriff Palliative Care entstand. 1985 führte das britische Royal College of Physicians die ärztliche Spezialisierung Palliative Care Consultant ein.
Palliative Care in der Schweiz
In der Schweiz entstanden in den 1970er Jahren verschiedene Freiwilligengruppen, darunter das Hospiz Aargau, die Zürcher Vereinigung zur Begleitung Schwerkranker und Freiwilligengruppen am Kantonsspital Baden. Palliative Medizin, Pflege und Begleitung wurde erstmals um 1980 am damaligen Centre des Soins Continus in Genf umgesetzt. Seit 1988 gibt es die Fachgesellschaft palliative ch mit rund 2000 Mitgliedern aus Pflege, Ärzteschaft, Seelsorgern und freiwilligen Sterbebegleitern.
2009 wurde die «Nationale Strategie Palliative Care» verabschiedet, um Palliative Care im Schweizer Gesundheits- und Sozialwesen zu verankern. Demnach geschieht die palliative Versorgung heute anhand einer Matrixstruktur mit einem ambulanten Bereich, einem Langzeit- oder Hospizbereich und einem akuten Stationärbereich.
Fachgruppe Palliative Care
Die Fachgruppe Palliative Care der Diakonie Schweiz deckt die spezifisch reformierte Perspektive ab und sorgt sich um die Vernetzung mit den Partnern.
Fachgruppe Palliative Care
- Co-Präsidium: Meierhofer-Lauffer Theres, Heimleiterin, Engelberg
- Co-Präsidium: Mösli Pascal, Beauftragter Spezialseelsorge und Palliative Care, Ref. Kirchen Bern-Jura-Solothurn
- Borer Evelyn, Synodalratspräsidentin, Ref. Kirche Solothurn
- Hess Daniela, Pfarrerin, Vereinigung der deutschschweizerischen evangelischen Spitalseelsorger*innen
- Hochuli Jürg, Bereichsleitung Gemeindedienste, Ref. Kirche Aargau
- Magnin Adrienne, aumônier en soins palliatifs
- Mayer Stefan (temporär), Präsidium Vereinigung der deutschschweizerischen evangelischen Spitalseelsorger*innen
- Trautvetter Helen, Beauftragte Palliative Care der Evang.-ref. Landeskirche des Kt. Zürich und Seelsorgerin am Zürcher Lighthouse
- Wohnlich Stefan, Pfarrer, Beauftragter Palliative Care der Evangelischen Landeskirche Kanton Thurgau
Nationale ökumenische Tagung Palliative Care 2022
Bericht
Vortrag T. Collaud
Vortrag A. Mühlegg
Vortrag A. Koehler
Vortrag M. Hänggi & R. Wuillemin
Vortrag L. Presenti Jacquaz
Spiritual Care
Schmerz, so Cicely Saunders, wird von mehreren Dimensionen beeinflusst: der physischen, sozialen, psychischen und spirituellen Ebene. Unerfüllte Spiritualität kann Schmerzen und Beschwerden verstärken. Was im Leben gilt, gilt in besonderer Weise auch am Lebensende. Die noch junge Disziplin der Spiritual Care bemüht sich darum, über den traditionell christlichen Kontext der Krankenhausseelsorge hinaus, Spiritualität und Religiosität als Bedürfnis auch kirchenferner oder nichtchristlicher Patientinnen und Patienten wahrzunehmen und zu erforschen. Spiritual Care versteht sich als Teilaspekt der Palliative Care.
In der Schweiz hat vor allem die Einrichtung einer Professur für Spiritual Care an der Universität Zürich für Aufmerksamkeit gesorgt. Simon Peng-Keller bietet in Zusammenarbeit mit der Medizinischen Fakultät ein interdisziplinäres Lehrangebot an (unter anderem den CAS Spiritual Care) und ist mit der Forschung in diesem Gebiet beauftragt. Mit dem von Isabelle Noth geleiteten CAS Spiritual Care lehrt auch die Universität Bern das Thema.
Auch die Fachgesellschaft palliative ch hat sich dem Thema angenommen und eine interdisziplinäre Taskforce Spiritual Care gegründet. Im Jahr 2018 legte sie Leitlinien zur interprofessionellen Praxis zur Spiritual Care in Palliative Care vor.
Leitlinien Spiritual Care
Eine Forschungsgruppe der WHO untersuchte die Rolle von Spiritualität und Religiosität für die Lebensqualität. Sie empfahl schon 2006, die als Teil der medizinischen Versorgung insbesondere bei schwerkranken Patientinnen und Patienten und bei solchen am Lebensende anzusprechen, da sie deren Lebensqualität massgeblich beeinflusse, heisst es in der Einleitung der Leitlinien. Spiritual Care sei die interprofessionelle Aufgabe, die spirituelle Dimension in die Gesundheitsversorgung einzubeziehen.
Im Kontext säkularer Gesundheitsinstitutionen und einer pluralistischen Gesellschaft stehe die Integration von Spiritual Care im schweizerischen Gesundheitswesen vor hohen Anforderungen, so das Autorenteam.
Spiritual Care bedürfe einer bewussten Einübung und einer Implementierung, die an Qualitätsstandards überprüfbar sei. Ein respektvoller Umgang mit religiösen und spirituellen Überzeugungen und Praktiken erfordere einen reflektierten Umgang mit den Grenzen des eigenen Wissens, Verstehens und Könnens. Die spirituelle Dimension menschlichen Lebens und die mit ihr verbundenen Einstellungen und Erfahrungen entzögen sich in ihrem Kern einer direkten Beeinflussung. Wichtig sei hingegen, sich klar zu machen, dass die Gesundheitsfachleute den Glauben oder Unglauben ihrer Patienten nicht teilen müssten, um für deren spirituelle Sensibilität offen zu sein.
Da die religiöse und spirituelle Dimension lebensbestimmend sei, müsse die professionelle Begleitperson mit einer respektvoll-unterstützenden Haltung herangehen. Ebenso sei zu respektieren, wenn die Patientinnen und Patienten keinen Bezug zum Thema hätten, betonen die Leitlinien. Grundsätzlich gehe es darum, die spirituellen Dimensionen von Krankheitssymptomen zu erkennen und auf kritische Momente und spirituelle Aspekte von Sterbeverläufen zu achten.
Um religiöse und spirituelle Überzeugungen und Wünsche aktiv in die Palliative Care einbeziehen zu können, bedürfe es einer achtsamen Wahrnehmung und eines direkten Erfragens und Ansprechens. Grundlegend sei die Fähigkeit, in allen Formen der Begegnung mit Patientinnen, Patienten und Angehörigen auf spirituelle Aspekte zu achten und sie wahrzunehmen. Besonders die Patientinnen und Patienten sollten dabei auf diskrete Weise Möglichkeiten zur Selbstmitteilung erhalten, betonen die Leitlinien. Das Ansprechen von Religiosität und Spiritualität könne Türen öffnen oder verschliessen, ein sensibler Umgang mit kultureller, spiritueller, religiöser und weltanschaulicher Diversität sei also unabdingbar.
Die Leitlinien führen sodann notwendige professionelle Grundkompetenzen sowie unterschiedliche Formen von Spiritual Care und professionsspezifische Rollen auf. Schliesslich wird beschrieben, was für die interprofessionelle Zusammenarbeit wichtig ist: so müsse die Frage nach der spirituellen Dimension regulär in interdisziplinäre Rapporte und Fallbesprechungen einbezogen werden. Da die Aspekte ausserdem bislang nicht Teil der gesundheitsberuflichen Ausbildung sei, bedürfe es einer vorgängigen Verständigung über Rollen, Sprachformen und Abläufen. Institutionelle Rahmenbedingungen und die Forderung nach Aus-, Weiter- und Fortbildung sind ebenfalls Teil der Leitlinien.
Leitlinien Seelsorge als spezialisierte Palliative Care
Die Fachpersonen der Seelsorge beteiligen sich als Spezialistinnen und Spezialisten an Spiritual Care als der gemeinsamen Sorge der verschiedenen Gesundheitsberufe um spirituelle Bedürfnisse, schreibt die Fachgruppe Seelsorge von palliative ch in einem aktuellen Dokument aus dem Jahr 2019. Die «Leitlinien Seelsorge als spezialisierte Spiritual Care in Palliative Care» wollen das seelsorgerliche Handeln in der Palliative Care systematisch beschreiben und mit Kriterien ergänzen.
Seelsorge beteiligt sich an der gemeinsamen Aufgabe, existentielle und religiös-spirituelle Themen und Fragestellungen von Patienten und Angehörigen wahrzunehmen und qualifiziert zu begleiten, so das Papier. Beschrieben werden dann die Begleitung der Patienten und Angehörigen, die interprofessionelle Zusammenarbeit, die Mitwirkung in der Organisation und die Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung.
Innerhalb des Betreuungsteams trägt die Fachperson der Seelsorge die Verantwortung für die religiöse Begleitung von Patienten und Angehörigen, betonen die Leitlinien. Sie bietet ihre Präsenz niederschwellig an, heisst es dort. Das Angebot kann folglich von Patientinnen und Patieten gewählt oder auch abgelehnt werden. Beides wird respektiert.
Innerhalb des Fachteams wiederum fördert die Seelsorgerin oder der Seelsorger die Sensibilität gegenüber der kulturellen Vielfalt, indem sie ihr Fachwissen über unterschiedliche kulturelle, religiöse und spirituelle Vorstellungen und Traditionen einbringt.
Dafür muss die Seelsorge natürlich integriertes Mitglied des interprofessionellen Teams sein, so die Leitlinien. Genauso wichtig sei, dass die Seelsorge als spezialisierte Spiritual Care überhaupt in die Organisationsstruktur der Institution und in die Abläufe der Zusammenarbeit integriert ist. Damit könne die Seelsorge auch für religiöse, spirituelle und lebensgeschichtliche Fragestellungen der Mitarbeitenden ansprechbar sein.
Grundlegend sei, dass sich die Fachperson der Seelsorge jeglicher Übergriffe sowohl in der Haltung als auch in Wort und Tat enthalte, unterstreicht die Fachgruppe. Das schliesse ideologisch gefärbte Beurteilungen, Beeinflussungen und Manipulationen mit ein.
Mehr Informationen in Ihrer Nähe
Informationen und Kontaktmöglichkeiten in Kirche und Sozialdiakonie.
Aargau
Baselland

Basel Stadt

Bern

Luzern

Schaffhausen

Solothurn

St. Gallen

Thurgau
Zürich
Noch mehr Informationen und Kontaktmöglichkeiten zum Thema in allen Bereichen.

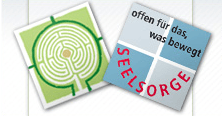
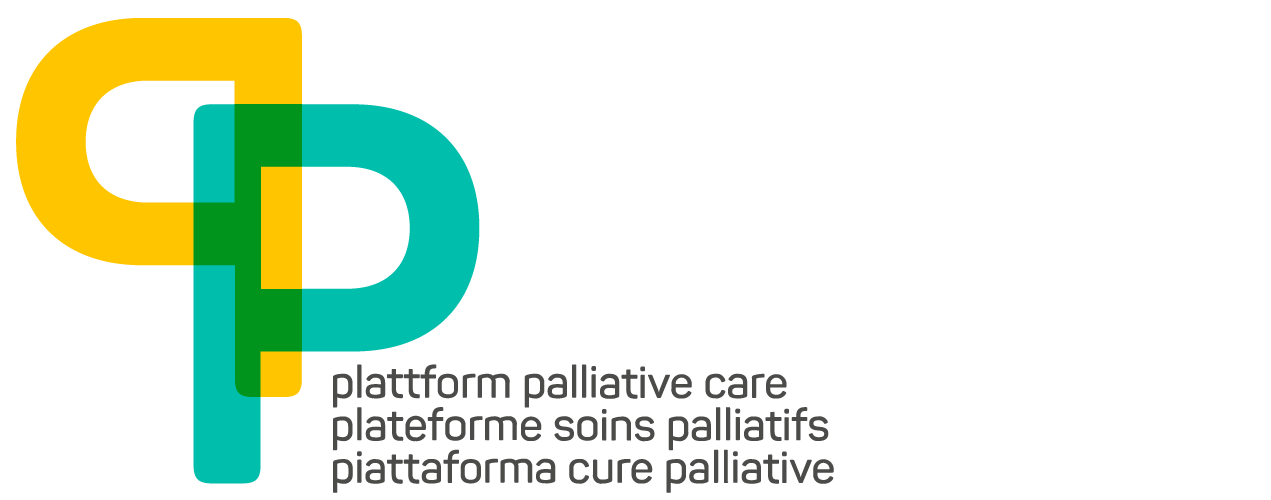
News und Magazinbeiträge
Lesen Sie hier Magazinbeiträge und Nachrichten aus unserem Newsfeed und dem elektronischen Magazin der Diakonie Schweiz.
Finanzmissbrauch im Alter hat stark zugenommen
Von 400 auf 675 Millionen Franken pro Jahr ist die Schadenssumme Finanzmissbrauch bei Personen 55+ in der Schweiz in den letzten fünf Jahren gestiegen, so Pro Senectute. Fast 80% wurden mit einem Betrugsversuch konfrontiert.
Fachtagung thematisiert Palliative und Dementia Care
Demenz sei eine Lebensform mit verändertem Erfahrungsraum, so ein Bericht der Evangelischen Landeskirche des Kantons Thurgau zu einer Fachtagung in der Kartause Ittingen.
Aktives Leben Schlüssel zu geistiger Fitness im Alter
Der vierte Teilbericht des Schweizer Altersmonitors untersucht den Zusammenhang von Freizeitaktivitäten und kognitiver Leistungsfähigkeit im Alter. Aktivität erhält die Gedächtnisleistung, so Pro Senectute dazu.
Aktuelle Zahlen zur Palliativpflege in der Schweiz
In der Palliativmedizin seien noch viele Aufgaben zu lösen, so das Nachrichtenportal SWI. Die Schweiz landet bei einer Studie zur Sterbequalität auf Platz 13 von 81.
Von der Auseinandersetzung mit der Endlichkeit des Lebens profitieren
Seit 2021 beitet die evangelische Landeskirche Thurgau “Letzte Hilfe”-Kurse zur Begleitung von Sterbenden an. Diese vermitteln ein verloren gegangenes Wissen, so ein Bericht der Kirche.
Studie zu Spiritual Care in der stationären Langzeitpflege
Eine nationale Studie will herausfinden, wie die spirituellen Bedürfnisse der über Palliative Care Betreuten in der stationären Langzeitpflege wahrgenommen werden. Die Befragung wird im Rahmen einer Masterarbeit durchgeführt, so der Branchenverband Curaviva.
Auf dem Weg zur demenzsensiblen Kirchgemeinde
Demenzbetroffene freuen sich, wenn sie wahrgenommen werden, so die Bernische Diakoniekonferenz zu demenzsensiblen Gemeinden. Statt sie als Problemzielgruppe zu sehen, sollten Gemeinden Beteiligungsangebote schaffen.
Bernische Diakoniekonferenz zu demenzsensiblen Kirchgemeinden
Demenzbetroffene freuen sich, wenn sie wahrgenommen werden, so die Bernische Diakoniekonferenz zu demenzsensiblen Gemeinden. Statt sie als Problemzielgruppe zu sehen, sollten Gemeinden Beteiligungsangebote schaffen.
120 Personen feiern Abschluss in Palliative und Spiritual Care
Eine Zertifikatsfeier zu Palliative Care wurde erstmals von den Aargauer Landeskirchen, Careum und dem Schweizerischen Roten Kreuz gemeinsam durchgeführt. 120 Absolventinnen und Absolventen feierten im Kultur und Kongresshaus Aarau.
St. Galler Kirchen bieten Kurse zur Begleitung von Menschen mit Demenz an
Seit drei Jahren führen die St. Galler Landeskirchen in Zusammenarbeit mit Alzheimer St Gallen-Appenzell Kurse für Freiwillige und Mitarbeitende in Kirchgemeinden durch, die zur Begleitung von Menschen mit Demenz ermöglichen sollen. Rund 200 Personen haben den Kurs schon besucht.
Aargauer Kirchen feiern 50 Jahre Seelsorge im Gesundheitswesen
Die Zusammenarbeit der Gesundheitsinstitutionen mit den beiden grossen Landeskirchen im Aargau sei schweizweit einzigartig, so die Reformierte Kirche Aargau in einer Medienmitteilung.
Potenzial Sozialer Berufe für Betreuung im Alter nutzen
Ein Papier der Paul Schiller Stiftung möchte verdeutlichen, wie die Kompetenzen von Fachkräften aus Sozialen Berufen für ältere Menschen besser genutzt werden können.
Impulspapier: Potenzial Sozialer Berufe für Betreuung im Alter nutzen
Ein Papier der Paul Schiller Stiftung möchte verdeutlichen, wie die Kompetenzen von Fachkräften aus Sozialen Berufen für ältere Menschen besser genutzt werden können.
Der Bedarf an Palliative Care in der Schweiz nimmt zu
Um 25 bis 30 Prozent wird der Bedarf an Palliative Care laut einer aktuellen Studie in der Schweiz bis 2050 steigen. Derzeit haben laut wissenschaftlichen Erkenntnissen rund 50000 Personen Bedarf. Für die Versorgungsplanung greife diese Schätzung jedoch zu kurz, so die Studie. Bedarf an der Versorgung in verschiedenen Strukturen haben laut Studie zwischen 104’000 bis 715’000 Personen.
Positionspapier assistierter Suizid als ethischer Grenzfall
Assistierter Suizid ist ein Grenzfall, wenn alles Menschenmögliche ausgeschöpft sei, so die Evangelische Kirche von Westfalen in einem Positionspapier. Besonderen Wert lege man auf eine intensive Suizidprävention.
Wie altern Menschen ohne betreuende Angehörige?
140´000 Menschen ältere Menschen leben in der Schweiz ohne betreuende Angehörige. Eine Studie hat untersucht, wie die zentrale Rolle unterstützender Angehöriger kompensiert wird.
Schaffhauser Kirchen weisen auf Wert von Palliative Care hin
Mit einer Standaktion setzt sich der Verein Palliative Care Schaffhausen für die Wertschätzung der Palliativarbeit ein, so die Landeskirchen in einer gemeinsamen Mitteilung.
Alterspolitik: Basler Kirchen lancieren Umfrage
Welche seelsorgerlichen und spirituellen Bedürfnisse Seniorinnen und Senioren im Kanton Baselland haben, wollen die Evangelisch-reformierte und Römisch-katholische Kirche mit einer Umfrage erfahren.
300’000 ältere Menschen leben an der Armutsgrenze
Fast 300’000 Personen über 65 Jahren leben aktuell in der Schweiz an der Armutsgrenze. 46’000 von ihnen sind ausweglos arm, so Pro Senectute in einer aktuellen Untersuchung.
Ökumenische Palliativbegleitung in Baselland bleibt
Das Rote Kreuz Baselland und die Ökumenische Koordinationsstelle Palliative Care Baselland schliessen sich in der Freiwilligenbegleitung im Bereich Palliative Care definitiv zusammen.
Nationaler Forschungstag Palliative Care in Bern
Erstmals seit 2019 veranstaltet die Forschungsplattform Palliative Care Schweiz am 25. August in Bern wieder einen nationalen Forschungstag.
Branchenverband stellt Tools für Personenzentrierung und interprofessionelle Zusammenarbeit vor
Eine Online-Sammlung von Materialien und Konzepten bietet Fachpersonen, Netzwerken und Gemeinden Ideen und Inputs. Dahinter steht der Branchenverband Curaviva.
Stadtgespräche vertiefen Diskussion über gute Betreuung im Alter
In Thalwil diskutieren Fachpersonen über bestehende Lücken in der Betreuung im Alter. Nur mit dem Einsatz aller lassen sich die demografischen Herausforderungen bewältigen, so die Paul Schiller Stiftung.
Fachtagung Palliative und Dementia Care
Die 4. Interdisziplinäre Ittinger Fachtagung in Palliative und Dementia Care versammelte am 19. Februar rund 100 Freiwillige und Fachpersonen zu einem Online-Fortbildungstag.
“Übergang in digitale Welt ist für Seniorinnen und Senioren eine Chance”
Viele ältere Menschen seien offline unterwegs und müssten deshalb bei technischen Neuerungen wie dem QR-Einzahlungsschein abgeholt werden, so Pro Senectute.
Diakonie Österreich fordert stärkeren Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung
Bestehende Lücken in der Hospiz- und Palliativversorgung in Österreich müssten geschlossen werden, so die Diakonie Österreich, die einen Rechtsanspruch auf diese Leistungen fordert. Auch müsse die Grundversorgung öffentlich finanziert werden.
Netzwerk fordert Gerechtigkeit beim Zugang zur Palliativversorgung
Es gibt eine massive palliative Unterversorgung von Nicht-Tumorpatientinnen und -patienten in der Schweiz, so palliative ch anlässlich des Welt Hospiz- und Palliative Care-Tages am 9. Oktober. Das Netzwerk fordert einen gleichberechtigten Zugang zur Palliative Care für alle.
Neue Studie zu Kosten und Finanzierung guter Betreuung im Alter
In der Schweiz sind 620’000 ältere Menschen auf Betreuung angewiesen, doch nicht alle können sich diese leisten. Und es werden immer mehr. Eine neue Studie der Paul Schiller Stiftung berechnet, was gute Betreuung für alle Betagten kostet und wie sie finanziert werden sollte. Auch volkswirtschaftlich betrachtet habe gute Betreuung einen deutlichen Nutzen, so die Studie.
Thesen zur Lebenskunst des Alter(n)s
Ältere Menschen sind Menschen im aktiven Alter. Sie haben viele Erfahrungen, sind gerne aktiv, wollen etwas Sinnvolles zur Gemeinschaft beitragen. Mehr als die Hälfte engagiert sich ehrenamtlich. Mit einer Zusammenfassung von Thesen für die kirchliche Altersarbeit haben sich nun mehrere reformierte Kantonalkirchen im Thema positioniert.
Berner Fachhochschule stellt Empfehlungen für generationsübergreifende Wohnprojekte vor
Das Institut für Alter der BFH dokumentierte Erfahrungen einer Berner Generationenwohnsiedlung und leitet daraus Empfehlungen für künftige Projekte ab.
Rotes Kreuz und Kirchen vermitteln gemeinsam palliative Begleitung
Das Rote Kreuz und die Ökumenische Koordinationsstelle Palliative Care Baselland bieten für ein Pilotjahr eine einheitliche Anlaufstelle für die Palliative Care – Begleitung.
“Ein Durchbruch für die Palliative Care in der Schweiz”
Die gesetzliche Regelung der Betreuungsfinanzierung von Menschen am Lebensende ist dringlich, so die Schweizerische Gesellschaft für Palliative Pflege. Die Annahme der Palliativ-Motion durch den Nationalrat sei ein Meilenstein.
Ist Suizidbeihilfe Aufgabe der Diakonie?
Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat das seit 2015 bestehende Verbot geschäftsmässiger Suizidassistenz für verfassungswidrig erklärt. Der Gesetzgeber muss nun festlegen, unter welchen Voraussetzungen diese Suizidassistenz ermöglicht wird. Eine grosse Herausforderung für die Diakonie, wie die aktuelle Debatte zeigt. Einblicke in Deutschland und ein Vergleich mit der Schweiz.
Themenheft Sorge und Seelsorge für Sterbende erschienen
Ein Themenheft der deutschen Kirchen trägt medizinische, ethische und seelsorgerliche Perspektiven der Palliativversorgung zusammen. Es enthält unter anderem Beiträge zur palliativen Geburt und zur Sorge um Sterbende unter Corona-Bedingungen.
Zürcher Kirche finanziert Lehrstuhl für Spiritual Care weitere sechs Jahre
Die Reformierte Zürcher Kirchensynode will das kirchliche Engagement im Bereich Palliative Care stärken. Unter anderem wird der Lehrstuhl für Spiritual Care an der Universität Zürich für weitere sechs Jahre finanziert.
Österreich diskutiert Sterbehilfe – Diakonie will Verbot unter Härtefallberücksichtigung
Ob der assistierte Suizid in Österreich erlaubt sein soll, diskutierte am 24. September der Verfassungsgerichtshof in einer öffentlichen Verhandlung. Eine Entscheidung trafen die Richter nicht. Die evangelische Kirche und Diakonie in Österreich sind für die Beibehaltung des Verbots, jedoch solle in Härtefällen Barmherzigkeit gezeigt werden.
Bundesrat will Palliative Care für alle möglich machen
Die bestehenden Angebote der Palliative Care sind noch nicht ausreichend in die Gesundheitsversorgung integriert, so der Bundesrat in einer Medienmitteilung. Der Zugang soll für alle Menschen in der Schweiz möglich sein.
Nationale ökumenische Tagung beleuchtet “Sterbenarrative” in Palliative Care
Erzählen am Lebensende führt Sterbenden die Essenz ihres Lebens vor Augen und gibt ein Stück Selbstbestimmung, so ein Ergebnis der nationalen ökumenischen Tagung “Sterbenarrative – Bedeutung für die Seelsorge in Palliative Care” am 9. September in Bern.
Verzeihen und Vergeben als Prävention für das Lebensende
Ein Themenabend der Lehrgänge in Palliative und Spiritual Care der Aargauer Landeskirchen beschäftigte sich mit dem Umgang mit Schuld und Kränkung angesichts des Lebensendes. Loslassen sorgt für Seelenfrieden, so das Fazit.
Diakoniewerk gründet Kompetenzzentrum für “Spiritual Care”
Ein neues Kompetenzzentrum für Spiritual Care will das Diakoniewerk Gallneukirchen den Aufbruch in eine neue Erfahrung glaubwürdiger und lebendiger Care-Organisationen wagen und eine neue Verbindung zwischen Mensch und Organisation schaffen.
“Sterbenarrative” im Horizont von Spiritual Care
Wer erzählt, wird sich selbst präsent, schafft Bezüge und tritt in Beziehung. Eine differenzierte Wahrnehmung des Erzählens am Lebensende soll dazu beitragen, Schwerkranke und Sterbende bei ihrer narrativen Sinnsuche zu begleiten.
Palliative Care-Begleitdienst im Aargau wieder aufgenommen
Die Aargauer Landeskirchen haben seit dem 17. Juni ihren Palliative Care-Begleitdienst für schwer kranke und sterbende Menschen in Institutionen und in häuslicher Pflege mit ausgebildeten Freiwilligen wieder aufgenommen.
Corona: Zwei Drittel der Menschen ab 50 fürchten um ihr Ansehen
Viele ältere Menschen konnten während der Corona-Krise auf Unterstützung zählen. Trotzdem sind zwei Drittel unsicher, ob das Verhältnis zwischen Jung und Alt langfristig unter der Krise leiden könnte, so Pro Senectute Schweiz.
“Die Lücken in der Betreuung älterer Menschen sind gross”
Grundlagen für die Klärung und Umsetzung guter Betreuung im Alter sind aktueller denn je, sagen sechs Stiftungen, die gemeinsam einen Wegweiser zum Thema veröffentlichen. Der Fokus auf die in erster Linie medizinisch ausgerichtete Pflege greife zu kurz.
Sechs Stiftungen lancieren Wegweiser für gute Betreuung im Alter
Grundlagen für die Klärung und Umsetzung guter Betreuung im Alter sind aktueller denn je, sagen sechs Stiftungen, die gemeinsam einen Wegweiser zum Thema veröffentlichen. Der Fokus auf die in erster Linie medizinisch ausgerichtete Pflege greife zu kurz.
Ständerätin Marina Carobbio Guscetti neu zur Präsidentin von palliative ch gewählt
Mit Marina Carobbio Guscetti konnte palliative ch eine kompetente Gesundheitspolitikerin als Präsidentin gewinnen, schreibt der Verband iin einer Mitteilung. Die Delegierten von palliative ch bestätigen demnach die Wahl der Tessiner Ärztin und Ständerätin per 1. Juni 2020.
“Corona-Regeln werden von Senioren zunehmend als eine Form von Diskriminierung empfunden”
Die Corona-Massnahmen haben den Kollateraleffekt, dass sich die Meinung zum stereotypen älteren Menschen verschärft, so die Dachorganisation “Alter ohne Gewalt”. Unbeabsichtigt trügen sie zu Altersdiskriminierung und Infantilisierung von Senioren bei.
Pro Senectute startet Telefonkette für ältere Menschen
Zu den Risikogruppen des Coronavirus gehören ältere Menschen, die sich zum eigenen Schutz zunehmend ins Private zurückziehen müssen, schreibt Pro Senectute. Eine Telefonkette soll gegen die soziale Isolation helfen.
Nur wenige lassen sich zur Wohnsituation im Alter beraten
Alle wollen wissen, wie die eigene Wohnsituation im Alter sein wird. Nur jeder Zehnte hat sich aber vor der Pensionierung dazu beraten lassen, sagt eine neue Studie von Pro Senectute und Raiffeisen.
Diakonie Deutschland veröffentlicht Handbuch für Hospiz-Arbeit
Ein neuer Leitfaden für stationäre Hospizarbeit stellt die Bedürfnisse der Hospizgäste in den Mittelpunkt und gibt Empfehlungen für die Arbeit in der Praxis.